Zurück
Finanzielle Hilfe bei Pflege, Krankheit und Behinderung: Orientierung im Schweizer System
12.9.2025
Wer durch Krankheit, Unfall oder von Geburt an mit einer Einschränkung lebt, hat in der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf finanzielle Unterstützung – doch welche Leistungen gibt es? Im folgenden Blogartikel finden Sie eine übersichtliche Erläuterung zu den verschiedenen Leistungen.
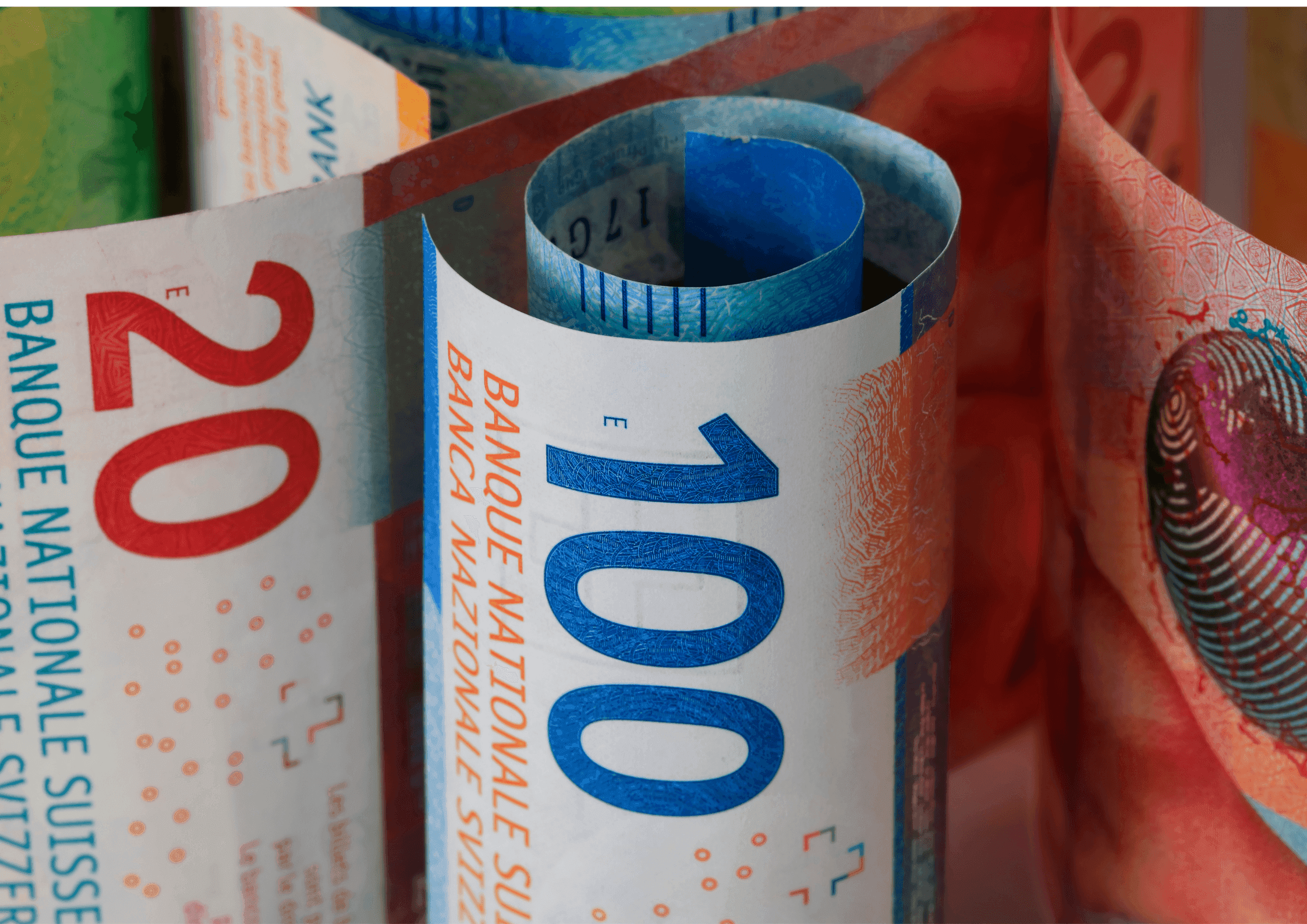
Welche Leistungen gibt es? Eine Übersicht
Wir haben die verschiedenen Leistungen, welche in der Schweiz je nach Situation bezogen werden können, grob in 5 Kategorien unterteilt:
Leistungen der Sozialversicherungsanstalten (SVA)
Dazu gehören Invalidenversicherung (IV), Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Ergänzungsleistungen (EL), Hilflosenentschädigung (HiLo), und die Prämienverbilligung (aber: die Prämienverbilligung ist kantonal geregelt und der Antrag erfolgt nicht in allen Kantonen an die SVA).
Leistungen der Unfallversicherung
Hierzu zählen Unfallrente, Taggelder bei Arbeitsunfähigkeit infolge Unfall sowie Heilbehandlung (Heilungskosten u. bestimmte Pflegekosten) und Hilfsmittel bei einem Unfall.
Leistungen der Krankentaggeldversicherung
Diese leisten Lohnersatz bei längerer Krankheit, wenn eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wurde. Jedoch übernimmt diese nur 80% des Lohns und zahlt in der Regel maximal während 2 Jahren Taggelder aus.
Leistungen der Krankenkasse
Dazu gehören zum Beispiel die Pflegefinanzierung und die Vergütung von Hilfsmitteln und bestimmter Therapien sowie Medikamenten.
Leistungen von Kantonen und Gemeinden
Darunter fallen die Pflege-Restfinanzierung, Sozialhilfe sowie Beiträge für Wohnungsanpassungen, Betreuungsleistungen und Transportkosten bei Behinderung.
1. Leistungen der Sozialversicherungen: IV, AHV, EL
Invalidenversicherung (IV)
Die IV unterstützt Personen, die dauerhaft aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten können. Sie zahlt IV-Renten als finanzielle Hilfe und übernimmt weitere wichtige Leistungen wie Assistenzbeiträge zur selbstständigen Lebensführung, Eingliederungsmassnahmen zur beruflichen oder schulischen Wiedereingliederung sowie gegebenenfalls Taggelder während dieser Massnahmen. Zudem erhalten IV-Rentner*innen Kinderzulagen für ihre unterhaltspflichtigen Kinder.
Zu beachten: Der Bezug einer IV-Rente schliesst nicht grundsätzlich den Erhalt anderer Leistungen aus. Die Krankentaggeldversicherung bezahlt jedoch in der Regel solange, bis eine Rentenanspruch besteht – sobald eine IV-Rente bezogen wird, entfällt der Anspruch auf das Krankentaggeld. Zudem wird die IV Rente im Rentenalter von der AHV abgelöst.
- IV-Rente
- Assistenzbeiträge
- Eingliederungsmassnahmen sowie Taggelder während dieser Massnahmen
- Kinderzulagen bei IV-Rentner*innen
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
Die AHV ist die Schweizer Rentenversicherungen für das Alter und Hinterlassene. Nebst den Altersrenten, zahlt sie auch Hinterlassenenrenten an Witwen, Witwer und Waisen aus.
Ergänzungsleistungen (EL)
Die EL können Personen erhalten, die in der Schweiz wohnen, eine AHV- oder IV-Rente, eine Hilflosenentschädigung oder Taggelder der IV beziehen. Zudem muss nachgewiesen werden können, dass das Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um die anerkannten Lebensunterhaltungskosten zu decken. Zum Einkommen zählen hierbei unter anderem auch die IV- oder AHV Rente. EL können auch in Pflegeheimen oder betreuten Wohnformen bezogen werden. Sie unterstützen unter anderem bei der Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen.
Ergänzungsleistungen sind ergänzend zu AHV- und IV-Renten, ersetzen in der Regel aber die Sozialhilfe, denn EL haben Vorrang vor Sozialhilfe - wer EL erhält, soll keine Sozialhilfe benötigen.
Hilflosenentschädigung (HE/HiLo)
Für den Bezug einer HE ist die Voraussetzung eine dauerhafte Hilfebedürftigkeit im Alltag. Dauerhafte Hilfsbedürftigkeit bedeutet, dass der oder die Betroffene im Falle von IV für mindestens ein Jahr und im Falle von AHV für mindestens ein halbes Jahr auf Unterstützung angewiesen ist. Zudem muss Betroffene mindestens in zwei Lebensbereich regelmässig und in erheblichem Ausmass auf Hilfe angewiesen sein.
Zu den relevanten Lebensbereichen in denen Hilflosenentschädigung bezogen werden kann zählen:
Zusätzlich zu diesen Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) können auch ein dauernder Überwachungsbedarf oder eine dauernde lebenspraktische Begleitung (oft bei psychischen Beeinträchtigungen) relevant sein.
Pflegeleistungen, Heimaufenthalt oder administrative Unterstützung zählen nicht zu den anerkannten Kriterien. Bei Pflegebedarf und Heimaufenthalten greifen andere Leistungen wie die Pflegefinanzierung gemäss KVG, die Restfinanzierung der Kantone oder Gemeinden sowie EL (bei unzureichendem Einkommen). Der Erhalt anderer Leistungen schliesst den Bezug von HE nicht aus.
Welche Stelle für die Hilflosenentschädigung zuständig ist, hängt nicht nur vom Alter ab, sondern auch von dem auslösenden Grund für die Hilflosigkeit:
- Bei Hilflosigkeit infolge einer Behinderung oder Krankheit vor dem Rentenalter ist in der Regel die IV zuständig.
- Tritt die Hilflosigkeit nach dem AHV-Rentenalter auf, wird die Leistung von der AHV übernommen.
- Ist die HIlflosigkeit die Folge eines Unfalls, fällt die Leistung in den Zuständigkeitsbereich der Unfallversicherung (UVG).
2. Leistungen der Unfallversicherung (UV)
Die Unfallversicherung (UV) wie unter anderem die Suva bieten Schutz und finanzielle Unterstützung bei Unfällen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.
Unfallrente und Taggelder
Bei dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen infolge eines Unfalls zahlt die Unfallversicherung eine Unfallrente. Während der Arbeitsunfähigkeit werden Taggelder als Lohnersatz ausgerichtet. Ab erreichtem AHV-Alter wird die Unfallrente um 20% gekürzt, jedoch nicht gestrichen, sofern der Unfall unter dem AHV-Rentenalter passiert ist. Ist der Zeitpunkt des Unfalls nach Erreichen des AHV-Alters, entfällt die Unfallrente sowie Taggelder. Heilungskosten und Hilfsmittel können aber dennoch übernommen werden (s. unten).
Hinweis: Auch bei Bezug einer Unfallrente oder Taggeldern sind andere Leistungen nicht ausgeschlossen. Die teilweise Pflegefinanzierung der Krankenkasse, die Restfinanzierung durch den Kanton oder die Gemeinde, Hilflosenentschädigung sowie Ergänzungsleistungen können zusätzlich beantragt werden, sofern die Kriterien erfüllt sind. Dasselbe gilt für die Sozialhilfe.
Heilungskosten und Hilfsmittel
Die Unfallversicherung übernimmt die Kosten für Behandlungen, Therapien und medizinisch notwendige Hilfsmittel und teilweise Pflege infolge eines Unfalls. Diese Sachleistungen werden auch nach Erreichen des AHV-Alters noch geleistet. Ist die Ursache für den Bedarf an Hilfsmitteln nicht ein Unfall, kommen andere Leistungen zum Tragen:
- AHV: Nach Erreichen des AHV-Alters können einfache Hilfsmittel über die AHV bezogen werden. Dazu gehören beispielsweise Lupen, Hörgeräte oder Gehstöcke.
- Krankenkasse: Unabhängig vom Alter übernimmt die Krankenkasse medizinisch notwendige Hilfsmittel gemäss Mitel- und Gegenständeliste (MiGeL), welche vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) geführt wird.
- IV: Wenn die Hilfsmittel für die Eingliederung ins Arbeitsleben oder zur Selbstständigkeit im Alltag notwendig sind, können sie vor dem Erreichen des Rentenalters, über die IV abgerechnet werden. Im Gegensatz zu den von der Krankenkasse übernommenen Hilfsmitteln, müssen die von der IV übernommenen Hilfsmittel nicht medizinisch notwendig sein. Zu den "Hilfsmitteln" gehören auch Anpassungen der Wohnumgebung, damit sie behindertengerecht wird.
3. Krankentaggeldversicherung (KTG)
Bei längerer Krankheit, die nicht durch einen Unfall verursacht wurde, kann eine Krankentaggeldversicherung greifen, die einen Teil des Lohnausfalls deckt. Diese wird häufig privat oder durch den Arbeitgeber abgeschlossen, ist aber nicht obligatorisch und greift nur, sofern vorgängig eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wurde.
Hier werden in der Regel maximal 2 Jahre Taggelder ausbezahlt und die einzelnen Tagessätze werden auf der Basis von 80% des Monatslohnes berechnet und ausgerichtet.
4. Leistungen der Krankenkasse: Pflegefinanzierung und Hilfsmittelvergütung
Die Krankenkassen übernehmen in der Schweiz gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) wichtige Leistungen zur Unterstützung bei Krankheit und Behinderung. Von besonderer Relevanz sind dabei die Pflegefinanzierung sowie die Vergütung medizinisch notwendiger Hilfsmittel.
Pflegefinanzierung
Die Krankenkasse übernimmt einen gesetzlich festgelegten Beitrag an die Kosten für Pflegeleistungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die betroffene Person zuhause oder im Pflegeheim wohnt. Voraussetzung für die Übernahme des Anteils der Krankenkasse ist, dass die Pflege medizinisch notwendig ist und durch eine anerkannte Fachperson erbracht wird. Als anerkannte Fachperson gelten sowohl diplomierte Pflegefachpersonen als auch Spitex-Organisationen mit entsprechender Bewilligung.
Der Kanton oder die Gemeinde übernehmen einen Teil der Pflegekosten, den sogenannten Restfinanzierungsanteil. Das ist der Kostenanteil, der nach Abzug des Krankenkassenbeitrags sowie der Verrechnung der Patientenbeteiligung übrig bleibt.
Hilfsmittelvergütung
Medizinisch notwendige Hilfsmittel wie Rollstühle oder Hörgeräte werden ebenfalls von der Krankenkasse vergütet. Die Voraussetzung für die Übernahme der Kosten ist, dass das Hilfsmittel auf der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) des Bundesamts für Gesundheit aufgeführt ist und die medizinische Notwendigkeit gegeben ist. Letzteres wird mittels ärztlicher Verordnung bestätigt.
5. Leistungen von Kantonen und Gemeinden
Neben den Bundesleistungen gibt es kantonale und kommunale Angebote, die vor allem ergänzend unterstützen.
Restfinanzierung Pflege
Pflegekosten, die von der Krankenkasse nur anteilig bezahlt werden, müssen durch andere Quellen gedeckt werden. Die Restfinanzierung ist der Teil der Pflegekosten, der nicht durch Krankenkasse oder Patientenbeteiliugng gedeckt ist. Dabei werden sowohl ambulante Pflege als auch stationäre Pflege im Heim vergütet. Der Anspruch auf die Restfinanzierung ist nicht einkommensabhängig und gesetzlich geregelt.
Prämienverbilligung
Menschen mit geringem Einkommen können eine Vergünstigung auf die Krankenkassenprämien beantragen. Die sogenannte Prämienverbilligung wird kantonal geregelt – die Kriterien, Antragstellung und Höhe der Vergünstigung unterscheiden sich daher je nach Wohnkanton. In manchen Kantonen erfolgt die Anmeldung automatisch oder über die Steuerdaten, in anderen muss aktiv ein Antrag bei der kantonalen Ausgleichskasse oder SVA gestellt werden. Teilweise leisten auch Gemeinden zusätzliche Beiträge.
Sozialhilfe
Reichen AHV-/IV-Renten, Ergänzungsleistungen oder andere Unterstützungen nicht aus, besteht ein Anspruch auf Sozialhilfe. Diese Hilfe sichert das soziale Existenzminimum und wird auf Gemeindeebene organisiert. Sozialhilfe wird subsidiär gewährt, das heisst: erst dann, wenn keine anderen Leistungen greifen oder beantragt werden können. Sozialhilfe umfasst neben dem Grundbedarf für den Lebensunterhalt auch Beiträge für Miete, Krankenkassenprämien oder situationsbedingte Leistungen wie Pflegezuschüsse.
Beiträge an Wohnungsanpassungen
Für Menschen mit Behinderung oder altersbedingten Einschränkungen kann eine barrierefreie Anpassung der Wohnung notwendig sein – z. B. der Einbau eines Treppenlifts, Haltegriffe im Badezimmer oder eine ebenerdige Dusche. Kantone und Gemeinden bieten hierfür teilweise Finanzierungsbeiträge oder Zuschüsse, oft in Zusammenarbeit mit Fachstellen für Behindertenhilfe oder via Stiftungen. Auch die Invalidenversicherung (IV) kann bei jüngeren Betroffenen mitwirken, insbesondere bei Eingliederungsziel.
Betreuungsleistungen und Entlastung
Einige Kantone und Gemeinden bieten Entlastungsdienste für pflegende Angehörige an – etwa in Form von:
- Finanziellen Beiträgen (z. B. Pauschalen für geleistete Betreuung)
- Betreuungsdiensten durch Freiwillige oder Organisationen
- Ferienbetten oder Tagesstrukturen zur temporären Entlastung
Diese Angebote sind je nach Region unterschiedlich ausgestaltet und müssen in der Regel beantragt werden. Ansprechpartner sind z. B. die kommunalen Sozialdienste, Pro Infirmis, Pro Senectute oder regionale Entlastungsdienste.
Beiträge für Transportkosten bei Behinderung
Menschen mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung haben oft erhöhte Transportkosten, etwa für Arzttermine oder Therapien. Zuschüsse oder Vergünstigungen für Fahrdienste, Behindertentaxis oder ÖV-Abonnements können bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden:
- IV (z. B. für Fahrkosten zu Massnahmen, vergünstigte ÖV-Billette und Begleitpersonen-Genrealabonement)
- Kantonale Fachstellen oder Sozialdienste
- Gemeinden
- Stiftungen (z. B. Pro Infirmis, Pro Senectute, SRK, Cerebral, Stiftung Behindertentransport)
Die Zuständigkeit variiert je nach Ausgangslage (z. B. Alter, Ursache der Behinderung, Art der Mobilitätsform). Eine frühzeitige Abklärung mit einer Fachstelle ist empfehlenswert.
Viele kantonale oder kommunale Angebote sind nicht standardisiert geregelt – es lohnt sich, sich bei der Gemeindeverwaltung, Spitex, Pro Infirmis oder einer Fachstelle für Sozialberatung individuell beraten zu lassen.
Aus unserer Erfahrung
In unserer täglichen Arbeit erleben wir oft, wie unübersichtlich das System der verschiedenen Leistungen auf den ersten Blick wirken kann – besonders, wenn plötzlich eine Pflegesituation entsteht. Viele Angehörige wissen zum Beispiel nicht, dass Hilflosenentschädigung und Ergänzungsleistungen zwei verschiedene Dinge sind und gleichzeitig möglich sein können, oder dass Hilfsmittel je nach Ursache ganz unterschiedlich finanziert werden.
Gerade für betreuende Angehörige, die wir bei uns anstellen, ist es hilfreich, wenn sie wissen, welche Unterstützung ihnen zusätzlich zusteht – sei es durch die Restfinanzierung der Pflege, die Prämienverbilligung oder Beiträge für Entlastungsleistungen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass gut informierte Angehörige ihre Rolle langfristig besser tragen können – und dass finanzielle Entlastung oft mehr möglich ist, als man denkt.
Das Schweizer Sozialsystem ist komplex und vielfältig. Je nach Lebenssituation, Ursache der Einschränkung und Wohnort können unterschiedliche Leistungen beantragt werden. Die Einteilung in Sozialversicherungen, Unfallversicherung, Krankenkasse sowie kantonale und kommunale Leistungen hilft dabei, die Angebote besser zu verstehen und gezielt Unterstützung zu finden.